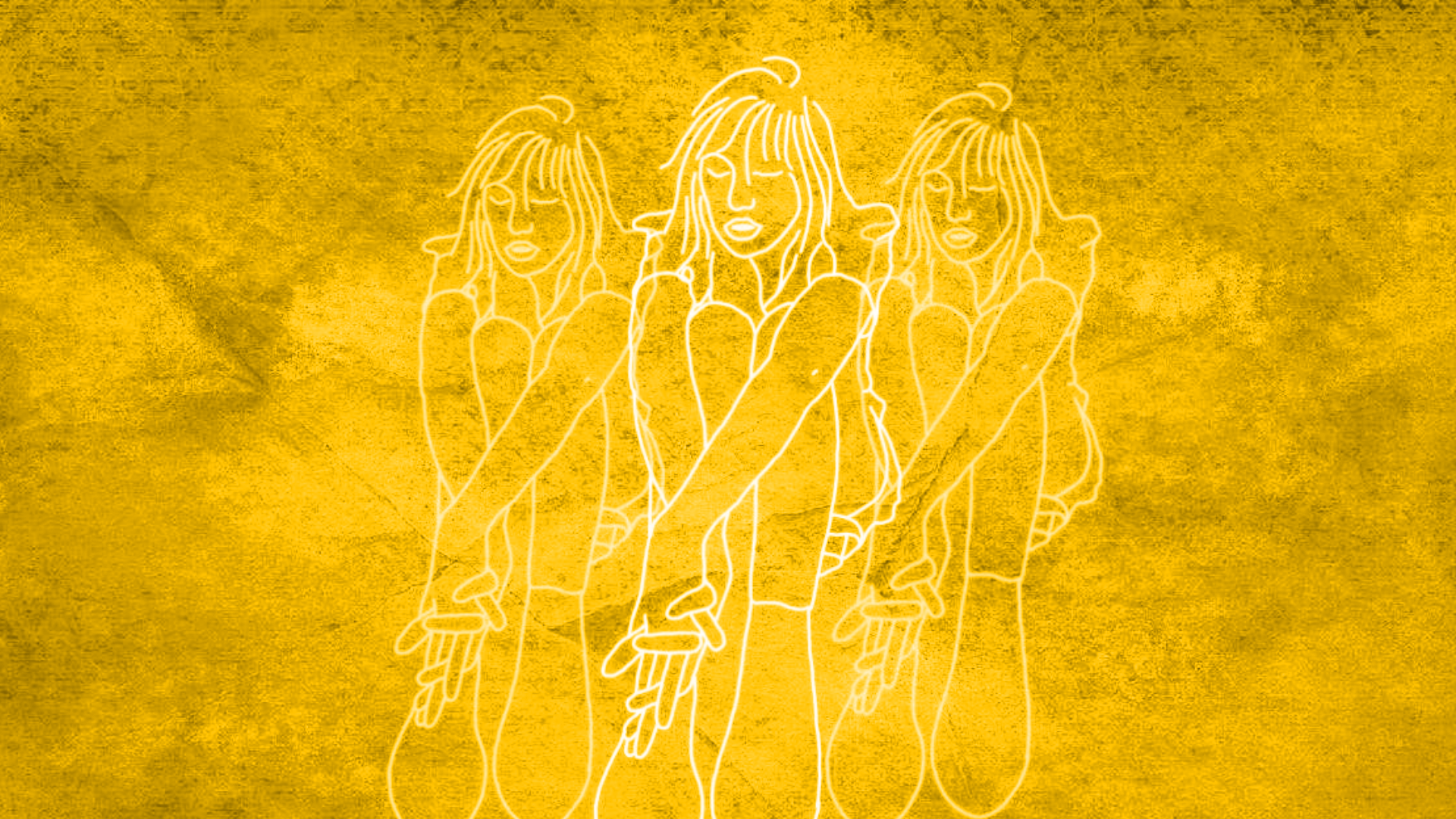Eine Filmkritik von Damian Arnold
Sollte man bisher um das Phänomen „Mean Girls“ herumgekommen sein, so darf man sich durchaus glücklich schätzen, denn schon der erste Film aus dem Jahr 2004 war nicht gelungen. Da nun die Filmadaption des Broadway-Musicals in den Kinos anlief, sei die seit zwanzig Jahren bekannte Handlung nur grob umrissen: Cady (Angourie Rice) muss nach einem Umzug zum ersten Mal eine Schule besuchen und wird von ihrer neuen Freundin Janis (Auli’i Cravalho) dazu gebracht, die „Plastics“, eine Gruppe oberflächlicher, verwöhnter und Ton angebender Mädchen, zu infiltrieren. Dabei gerät sie mit der Anführerin Regina George (Reneé Rapp) aneinander und nimmt im weiteren Handlungsverlauf ihren Platz ein.
Auch wenn das Original keine gute Komödie war, so konnte es doch einige humorvolle Momente erzeugen, die sich in das popkulturelle Gedächtnis einer Generation brannten. Das war hauptsächlich dem brillanten Cast zu verdanken. Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lindsay Lohan und Lacey Chabert besetzten die Rollen perfekt und insbesondere McAdams schaffte es durch ihre Präsenz, uns mehr von ihrem Charakter zu zeigen, als das reine Drehbuch hergab. Das fehlt in der Neuauflage vollständig. Reneé Rapps Spiel ist zurückhaltend und knöchern, ihre Mimik passt nie zu dem, was gerade in den Songs durch ihre Stimme ausgedrückt werden soll. Angourie Rice wurde wohl am Set gesagt, dass sie auf ihre eigentlichen Fähigkeiten verzichten soll, um kein zu großes Gefälle in den Performances erkennbar werden zu lassen, und Auli’i Cravalho verwechselt den Film in jeder Szene mit einer Nickelodeon-Sitcom. Einzig und allein Avantika in der Rolle von Karen merkt man große Spielfreude an, die kann sie aber abseits von dem einzigen gelungenen Witz des Films nie ausnutzen, da das Drehbuch ihren Charakter aus Gründen einer verlogenen politischen Korrektheit um viele Momente beschnitt.
Im Original verkörperte Karen noch sämtliche Klischees der dummen Blondine mit üppigem Körperbau. Nun hat man sie zu einer dummen Person of Colour mit üppigem Körperbau gemacht, tauschte somit ein abgeschmacktes Stereotyp gegen ein neues und meint sich damit auf der Seite des Fortschritts zu befinden. Wie schon beschrieben, fielen die meisten ihrer Pointen der Schere zum Opfer, hinzu kommt aber, dass man sich zwanzig Jahre später auch anders den Witzen gegenüber verhält. Bestand die Stärke von Amanda Seyfrieds Karen noch darin, dass sie ihr Bestes gibt, ihr Leben zu bestreiten und ihre fehlende Intelligenz für sie keine Rolle spielt, steht Avantika fortwährend über der Prämisse ihrer Rolle, tritt in Distanz und ironisiert die im Witz vorhandene Ironie abermals. Der Umgang mit ihrer Figur steht exemplarisch für den Rest des Films, der meint, dass die Hyperironie als Update für den Stoff reiche.
Der Film von 2004 verfügte noch über einen umfangreichen Soundtrack, der Klassiker und (damalige) Neuheiten der Pop-Musik in sich vereinte und in den entsprechenden Situationen einbrachte. Eine Musical-Adaption hätte das aufgreifen oder gar für Verfremdung durch unerwartete Stile sorgen können. Doch Jeff Richmond erweist sich als ideenloser Komponist und lässt schnell zusammengeschusterte Pop-Songs auf das Publikum los, die klingen, als hätte man nie etwas anderes als Musik von Billie Eilish, Olivia Rodrigo oder Ariana Grande gehört. Zudem besteht ein Großteil der Songs daraus, die Handlung zu erklären. Ikonische Musical-Songs schafften es immer, unabhängig vom Stück zu funktionieren und einfachen Elementen einen hohen Wiedererkennungswert zu verleihen. Bei „Mean Girls“ gibt es nur zwei Songs, welche als eigenständige Werke funktionieren („Sexy“ und „Someone Gets Hurt“), doch beide gehen unter in gleich klingender Soße an Chart-Musik.

Was man bei Schauspiel und Musik nicht wagte, versucht man in der Kameraarbeit auszugleichen. Da wird ein wenig mit der Kulissenhaftigkeit gespielt und es gibt einige handwerklich ordentliche Plansequenzen. Allerdings liegt dem ganzen der Trugschluss zu Grunde, dass eine dynamische Kamera dem, was sie abbildet, mehr Leben einhauche. In Wahrheit werden durch den Kontrast das salzsäulenartige Schauspiel, die einfallslosen und unmotivierten Choreografien sowie die sterilen Umgebungen nur noch deutlicher.
Aber zugegebenermaßen sind alle vorher genannten filmkritischen Aspekte irrelevant, da es sich bei „Mean Girls“ eigentlich gar nicht um einen Spielfilm handelt. Stattdessen ist die mediale Form, an der man sich (unfreiwillig) orientierte, die Reaction, wie man sie von YouTube, Twitch und anderen Plattformen kennt. Der Film reagiert auf das Original und das Musical, bezeichnet die eigene Musik als „trashig“ und überspringt immer wieder Teile der Handlung. Es ist so, als würde ständig kurz die Pausetaste gedrückt werden, damit dann die Witze des ursprünglichen Materials kommentiert und angepasst werden können. Wie auch bei Reactions wird hier das Original notfalls zensiert, was sogar in einer Szene explizit angesprochen wird, in der man darauf verweist, eine möglichst niedrige Altersfreigabe erreichen zu wollen.
Die letzte Parallele zu Reaction-Videos ist das Fehlen dessen, was man als Inhalt bezeichnen möchte. Die Kernaussage des Originals war noch, dass das Gruppenverhalten etwas Animalisches sei und erst die Kommunikation auf Augenhöhe zivilisiere. Der Film baute damit einen enormen Widerspruch auf, da er ignorierte, wie Kommunikation zur Cliquenbildung führt und welcher zivilisatorische Prozess eigentlich dahintersteckt. Doch was hat sich nun geändert? Die Körperbilder sind andere, die rassistischen und sexistischen Tendenzen wurden (oberflächlich) eliminiert und die Sprache wurde im Allgemeinen entschärft. Die „Mean Girls” sind hier nur noch „Not So Nice Girls”, die sich nicht trauen, das Wort „Bitch” im Munde zu führen, aber dessen Implikationen immer noch ausbuchstabieren. Zunächst freut man sich vielleicht, dass die homophoben Ausdrücke des Originals verschwunden sind, bis man feststellt, dass die beiden homosexuellen Figuren des Films noch stereotypischer gezeichnet sind als zuvor. Und natürlich hat das alles nichts an der Grundaussage verändert, im Gegenteil. Dadurch, dass der Film auf die unverblümte Sprache des Originals verzichtet, ist der Hang dazu, sich in die vermittelte Ideologie fallen zu lassen, noch einmal gesteigert worden.
Besonders deutlich wird das am Ende, denn es ist der einzige Abschnitt, der eine größere dramaturgische Überarbeitung erfuhr. Im Gegensatz zum ersten „Mean Girls“ lässt Regina George hier tatsächlich die Fassade fallen. Der Film meint dadurch eine tiefere Ebene erreichen zu können, torpediert sich aber dabei, weil er zum einen diesen Umstand wie in einer schlechten Fanfiction durch den Medikamenteneinfluss auf die verletzte Regina herleitet und er zum anderen an der Naturalisierung der gesellschaftlichen Umstände festhält. Wenn Cady am Ende die Krone, welche sie als Ballkönigin erhielt, zerbricht und die Stücke anderen zuwirft, so ist das kein subversiver oder gar offen rebellischer Akt, da hier nie die Strukturen, welche hinter dieser Auszeichnung stehen, hinterfragt werden, sondern eine Person von einer privilegierten Position aus undemokratisch entscheidet, wer ebenfalls etwas von diesen Privilegien abbekommen sollte. Wie auch die Influencer schreit der Film „Self-Love“ und „Body Positivity“, will sich aber nicht von der Brutalität des nicht natürlichen Konkurrenzkampfes lösen, was den Statements jegliche verbliebene Kraft und Glaubwürdigkeit nimmt.
Reactions, Hyperironie und Fanfictions – Jean Baudrillard hätte sich sowohl gefreut als auch geärgert seine Thesen von den immer engmaschigeren Simulationsschleifen in nur einem Film bestätigt zu bekommen. Empfahl der Philosoph in seiner Monographie „Das Jahr 2000 findet nicht statt” noch die Neunziger zu überspringen, um diesen Simulationen zu entkommen, lässt sich nun feststellen, dass man wohl gut daran getan hätte, auch die Nuller auszulassen. Mit Blick auf die Veröffentlichungszeitpunkte („Mean Girls“ 2004, „Mean Girls 2“ 2011, „Mean Girls“ (Broadway) 2018, „Mean Girls“ 2024) und den bisherigen Einspielergebnissen der Musical-Verfilmung von ca. 83 Millionen Dollar gilt es sich also entschieden gegen diese Entwicklungen zu stellen, ansonsten dürfen wir für die kommenden Jahre wohl noch viel mehr nostalgische Neuauflagen aus den 2000er Jahren erwarten.